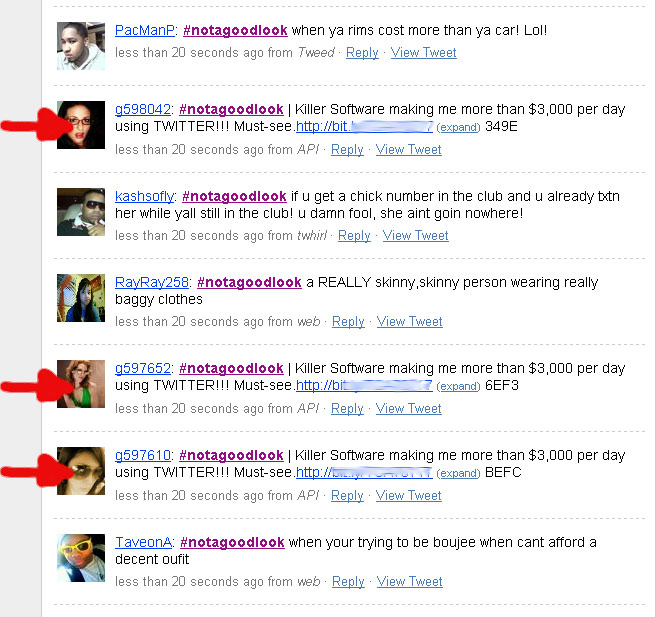Ach, die ollen 8-Bit-Maschinen! Mir wärmen sie das Herz, weil sie mich an meine Kindheit erinnern – mit welchen retronostalgischen Gefühlen wohl die heute Jungen den primitiven Netzwelten von StudiVZ und Facebook nachtrauern werden? – und außerdem: Mit 8 Bit, ein paar MHz Taktfrequenz und wenigen KByte (Ja! Kilobyte, nicht Mega-!) kann man eine Menge anstellen, wie jeder Arduino-Bastler bezeugen kann.
Zum Beispiel: Musik machen. Nicht, dass ich je ein begnadeter Keyboarder (oder Sänger oder gar, Gott bewahre, Gitarrist) gewesen wäre – aber dennoch lacht mein Herzelein darüber, dass die neue Wohnung Platz genug bietet, das Keyboard wieder aufzubauen. Das piece de resistance ist dabei das 155cm lange 88-Tasten-Masterkeyboard mit gewichteter Klaviatur – ein Produkt der Musikschrauberfirma Doepfer, von der ich das Gerät einst als Bausatz erworben habe. Das ist fast zwanzig Jahre her, und dennoch – dafür kann man Doepfer gar nicht hoch genug loben – dauerte es keine zwei Stunden, bis ich eine Antwort auf meine Supportfragen zu dem Gerät hatte. Vivat, Doepfer! (Von daher kann ich nur jedem, der ein Masterkeyboard sucht, einen Blick auf den Nachfolger meines LMK3 zu werfen – das Gerät ist verdammt wertstabil, technisch, musikalisch und emotional.)

Krachmacherecke: Masterkeyboard Doepfer LMK3 ohne eigene Klangerzeugung, die passiert in dem kleinen Rack: ein analog-fetter Oberheim Matrix 1000 (ca. 1990) und ein E-Mu ESI4000 Sampler mit hysterisch-historischer SCSI-Wechselfestplatte Iomega JAZ. Ein analoger Rackmischer und ein moderner USB-Soundadapter von M-Audio vervollständigen die Spielecke.
In letzter Zeit waren meine Liebste und ich anderweitig kreativ; jetzt ist die Kleine zuhause und ich bin es auch – mit Urlaub und immer wieder kleinen Ruhepausen, in denen die Mädels schlafen und ich basteln kann. Was in diesem Fall heißt: erst einmal wieder die alte Technik zusammenstöpseln – ein modernes USB-Audio-Interface von M-Audio sorgt für den Anschluss ans 21. Jahrhundert, analog wie digital.
Allerdings tauchen auch die bösen Geister der Vergangenheit wieder auf: Midi! Was für ein grausamer Murks von Schnittstelle! Für die historisch Unbewanderten: ein serieller Bus mit einer Datenrate von 38,25 kbit/s, was Anfang der Achtziger mal echt viel war. Schlimmer ist die merkwürdige Topographie: so eine Art Ring mit Darmschlingen und Polypen. Entweder man stöpselt ein Gerät in den Datenfluss, so dass es jedes einzelne Datenbyte erst selbst einmal anschauen und weiterreichen muss. Was bei der niedrigen Datenrate schnell zu hörbaren Verzögerungen führt und eine Menge Ärger bereit hält. Oder man nutzt alternativ den elektrisch durchgeschleiften Eingang, über den jetzt wiederum das angeschlossene Gerät nicht kommunizieren kann, also auch keine Einstelldaten rückmelden – das heißt praktisch: entweder man verdrahtet die Maschinen so, dass man sie vom Computer aus steuern kann, oder so, dass man sie live spielen kann. Puh.
Auch an anderen Stellen rückt mir die technische Frühneuzeit nahe. Der Sampler, immerhin ein Gerät, das nahe zu diesem Jahrtausend entstanden ist, holt sich die Daten für seinen 128MB-Hauptspeicher von einer SCSI-Wechselfestplatte. SCSI? Ja, da war mal was. In der frühesten Variante – und das ist die, die hier zum Einsatz kommt – ein 8 Bit breiter Parallelbus für maximal 7 Slaves an einem Master. Das antiquarische JAZ-Wechselfestplattenlaufwerk von Iomega klingt wie ein kleiner Düsenjäger und fasst gerade mal 2GB pro Medium, was jetzt nicht so dramatisch ist: mehr als maximal 9GB pro Speichermedium bewältigt die Firmware der Musikmaschine sowieso nicht.
Netter Gedanke: warum den alten Kram nicht durch moderneren Flash-Speicher ersetzen? Schöne Idee, allerdings teuer und umständlich. Erst mal braucht man einen SCSI-auf-IDE-Adapter, an den man dann wiederum einen CF-Karten-Adapter anschließen kann (eine IDE-auf-USB- oder gar SCSI-auf-USB-Lösung zum Anschluss von Speichersticks scheint es nicht zu geben). Damit ist man zwar die wackelige und lärmige alte Hardware los, aber auch über hundert Euro – und dafür gibt es dann schon fast einen konkurrenzfähigen Sampler in Software. Auch das wäre also eher der Nostalgie geschuldet als der Praxis – und diesen Trieb kann ich durch eine ungleich simplere Bastelei kanalisieren: den Sampler um sein internes Floppy-(!)-Laufwerk erleichtern und das JAZ-Drive ins Gerät einbauen. So wie Andrew Martens es mustergültig vorgemacht hat.
Eine Sache aus dem 21. Jahrhundert will ich der Spielecke aber doch gönnen: einen Musikrechner mit echtzeitfähiger Steuerung via Touchscreen, als Musiker-DJ-Allroundmaschine. Mit preiswerten Formbauteilen. Aber dazu später mehr.



 Was ich gerne getestet hätte, aber nicht durfte: Wohin das mit der Bewegungssteuerung führt, wenn man eine vernünftige Plattform testet. Sony-PK, Dienstagabend: Schönes Wetter, Häppchen, ein Gedränge, als stünden U2 oder wenigstens die Stones auf der Bühne, eine merkwürdigerweise vielbejubelte Rezessions-PS3 (20% schlanker, 25% billiger) – aber zum geplanten „Motion Controller“ nur der Satz: Den zeigen wir dann in einem Monat in Tokio. Suuuper. Bei Microsoft hinter den Kulissen bedauerndes Schulterzucken: Project Natal, die vielfach befabelte Kamera-Sensor-Kombi für wirklich immersives Spielverhalten? Dazu sage ich nicht mal, dass wir nichts dazu sagen; bedauere. Und auch Godgamegott Peter Molyneux, den ich zu seinem neuen Projekt Fable 3
Was ich gerne getestet hätte, aber nicht durfte: Wohin das mit der Bewegungssteuerung führt, wenn man eine vernünftige Plattform testet. Sony-PK, Dienstagabend: Schönes Wetter, Häppchen, ein Gedränge, als stünden U2 oder wenigstens die Stones auf der Bühne, eine merkwürdigerweise vielbejubelte Rezessions-PS3 (20% schlanker, 25% billiger) – aber zum geplanten „Motion Controller“ nur der Satz: Den zeigen wir dann in einem Monat in Tokio. Suuuper. Bei Microsoft hinter den Kulissen bedauerndes Schulterzucken: Project Natal, die vielfach befabelte Kamera-Sensor-Kombi für wirklich immersives Spielverhalten? Dazu sage ich nicht mal, dass wir nichts dazu sagen; bedauere. Und auch Godgamegott Peter Molyneux, den ich zu seinem neuen Projekt Fable 3